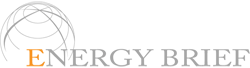Adobe: 609055210
Es sieht ganz so aus, als würde die Kernenergie weltweit und vor allem auch in Europa eine echte Renaissance erleben. Doch sie kann durch die gewaltigen Kosten und die Schwierigkeiten beim Bau neuer AKW für die westlichen Länder keine Sofortlösung sein. Außerdem ist Russland in diesem Bereich unverzichtbar.
Im März 2024 fand in Brüssel der erste internationale Kernenergie-Gipfel unter der Ägide der IAEO statt. Die Veranstaltung zeigte, dass die Kernenergie als Schlüsseltechnologie für die Steigerung der Energieversorgungssicherheit und die Dekarbonisierung gilt, und dass die weltweite Wahrnehmung dieser Technologie sich grundlegend verändert hat. „Lange Zeit hatten viele von uns Vorbehalte, doch die Zeiten haben sich geändert, die Sicherheitstechnologien sind weiterentwickelt worden, und natürlich hat sich unser Verständnis der Dringlichkeit einer fossilfreien Zukunft in den letzten Jahrzehnten dramatisch geändert“, so der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. „Damit die Energiewende gelingt, müssen wir jede verfügbare CO2-freie Energiequelle nutzen. Doch wir brauchen auch eine Quelle, die bei jedem Wetter zur Verfügung steht. Und das ist die Kernkraft.“
Der Gipfel, an dem hohe Vertreter von mehr als 30 Regierungen teilnahmen, kam zu dem Schluss, dass Russland weiterhin versucht, die internationale Gemeinschaft zu spalten, und zwar indem es sich das Thema Energie zunutze macht. Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, sagte bei der Konferenz: „Der Kreml hat das Thema Energie als effektive Waffe gegen Europa verwendet, um unsere Volkswirtschaften ins Chaos zu stürzen, die Gesellschaft zu schwächen und das Vertrauen zu untergraben.“
Vor diesem Hintergrund erscheint die Kernenergie als Möglichkeit, sich von externen Energielieferanten unabhängig zu machen. Den Gipfelteilnehmern ist genau bewusst, dass politischer Wille allein nicht ausreicht, um dieses Instrument zu nutzen – es muss auch ein umfangreiches Budget vorhanden sein. Der belgische Premier Alexander De Croo forderte die Europäische Investitionsbank auf, mit der Finanzierung von Kernenergieprojekten zu beginnen. „Es fehlt nicht an privaten Mitteln. Ganz im Gegenteil. Was fehlt, sind die richtigen Bedingungen, um Privatfinanzierung zu ermöglichen, und eine multilaterale Bank sollte als Hebel für verstärkte Investitionen dienen“, so De Croo.
Besonders förderlich für die Kernenergie in der EU war die Verabschiedung der EU-Taxonomie, eines Leitfadens für grüne Investitionen, im Jahr 2022. Nach langen Diskussionen wurden Erdgas und Kernenergie als „Brückentechnologien“ in das Dokument aufgenommen, um das Null-Emissionsziel der EU erreichen zu können. Die Taxonomie hat den Weg freigemacht für private Milliardeninvestitionen in Gas und Kernenergie – solche Projekte gelten jetzt als absolut klimafreundlich.
Das zeigt vor allem, dass sich die EU schon seit langem bewusst auf eine Akzeptanz der Kernenergie zubewegt. Und höchstwahrscheinlich kommt Frankreich in diesem Prozess eine Schlüsselrolle zu.
Frankreich als Vorbild für die ganze Welt
Was die Nutzung der Kernenergie betrifft, steht Frankreich in der EU unangefochten an der Spitze und spielt auch international eine führende Rolle. Nur die USA haben mehr im Betrieb befindliche AKW – Frankreich hat insgesamt 56 mit einer Gesamtleistung von etwa 61 GW. Der Anteil der Kernenergie an der französischen Stromproduktion beträgt etwa 70 Prozent, doch das Land hat nicht vor, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen: unter seinem Präsidenten Emmanuel Macron wurde der Bau von weiteren 14 AKW angekündigt, wobei für sechs davon die Finanzierung bereits geklärt ist.
Mitte 2023 wurde der Stromversorger EDF, der größte Betreiber von AKW weltweit, komplett verstaatlicht. Obwohl Frankreich schon immer stark auf Kernenergie gesetzt hat, galt noch bis vor kurzem für seine Energiepolitik das Ziel, die Kernenergie bis 2025 um die Hälfte zu reduzieren. 2019 wurde dieses Ziel auf 2035 verschoben, bevor es dann 2023 ganz aufgegeben wurde.
Die Renaissance der Kernenergie in Frankreich passt in einen weltweiten Trend. Nach dem starken Rückgang der Kernenergie nach dem Zwischenfall im AKW Fukushima 2011 hat die Technologie in den letzten 13 Jahren Schritt für Schritt wieder ihre alte Ausdehnung erreicht.
Bereits vor dem Brüsseler Gipfel unterzeichneten über 20 Staaten beim COP28-Klimagipfel der UNO eine Erklärung, in der sie sich verpflichteten, ihre vorhandenen Kernkraft-Kapazitäten bis 2050 zu verdreifachen. So plant zum Beispiel Großbritannien in naher Zukunft den Bau mehrerer kleiner Reaktoren und die Steigerung des Anteils der Kernenergie von 15 auf 25 Prozent bis 2050. Sogar Schweden, noch vor einigen Jahrzehnten ein vehementer Kernkraftgegner, hat jetzt seine nationalen Pläne auf Energie umgestellt, die „frei von fossilen Brennstoffen“ (aber nicht komplett erneuerbar) ist und plant den Bau von mindestens zwei Reaktoren.
Wie passt Deutschland in diesen Trend?
In diesem Zusammenhang lohnt sich eine Analyse des Beispiels Deutschland, der führenden europäischen Wirtschaftsmacht, die sich aus politischen Gründen zum Hauptkritiker der Kernenergie erklärt hat. Im April 2023 schaltete Deutschland seine letzten drei Reaktoren ab.

Adobe: 570378019
Die Grünen, die jetzt an der Macht sind, entstanden in den 1980er Jahren aus der Anti-Atomwaffen- und Anti-Atomkraft-Bewegung – die Abschaltung aller AKW war ein Kernpunkt ihres Wahlprogramms. Später, im Jahr 2011, wurde diese Position aufgrund der gesellschaftlichen Reaktion auf den Reaktorzwischenfall im japanischen Fukushima zur Norm und zur offiziellen Politik der Bundesregierung. Die Sicherheitsprobleme der Kernenergie konnten einfach nicht mehr ignoriert werden.
Auch wenn regelmäßig dazu aufgerufen wird, die alten Reaktoren erneut in Betrieb zu nehmen, entsteht doch der Eindruck, dass der Ausstieg aus der Kernenergie dafür zu umfassend war und dass eine solche Kehrtwende außerdem bei der Bevölkerung auf Unverständnis stoßen würde. Das erkennt auch die Bundesregierung an. Bundesumweltministerin Lemke dazu: „Es gäbe keinen Stromkonzern, der in Deutschland ein Atomkraftwerk bauen würde. Allein schon, weil die Kosten viel zu hoch wären. Weltweit können Atomkraftwerke nur mit massiver offener und versteckter Subventionierung wie der zumindest teilweisen Freistellung von der Versicherungspflicht gebaut werden.“ Momentan sieht es so aus, als sei der Atomausstieg tatsächlich endgültig.
Kernenergie – die bittere Wahrheit
Wie bereits erwähnt wird die Kernenergie immer häufiger als Möglichkeit betrachtet, die EU-Mitgliedstaaten und andere Länder bei der Energieversorgung von Russland unabhängiger zu machen. Gleichzeitig dominiert Russland jedoch nach wie vor den Markt für Kernbrennstoff und ist außerdem eines der aktivsten Länder, wenn es um den Bau neuer AKW auf der ganzen Welt geht. Es ist daher nur logisch, dass gegen die russische Atomwirtschaft im Gegensatz zum Öl- und Gassektor bislang noch keine Sanktionen verhängt wurden.
Die USA sind weltweit mit 30 Prozent der Gesamtproduktion führend bei der Kernenergie. Das Land schreckt nicht vor dem Kauf des extrem günstigen Kernbrennstoffs aus Russland zurück. Stattdessen importieren die Amerikaner laut Schätzungen für ihre 92 kommerziellen Kernreaktoren jährlich Brennstäbe aus Russland im Wert von einer Milliarde US-Dollar.
Selbstverständlich äußern die USA immer wieder ihren Unmut über diesen Umstand und erklären sich bereit, auf die Dienste Russlands zu verzichten. Im März kündigte eine Vertreterin des amerikanischen Energieministeriums an, dass die Mittel für die einheimische Produktion von Kernbrennstoff erhöht werden sollen, um es Kunden auf der ganzen Welt zu ermöglichen, die Lieferketten zu ändern und die russischen Fesseln abzustreifen. Dr. Kathryn Huff, eine hochrangige Vertreterin des Energieministeriums, erklärte gegenüber Reuters, die Teilnehmer des Brüsseler Kernenergiegipfels hätten einen gemeinsamen Versuch unternommen, die Investitionssumme zu berechnen, die notwendig ist, um die Lieferungen von Kernbrennstoff ohne Russland aufrechtzuerhalten. Die USA wollen hierfür 2,7 Milliarden Dollar aufwenden. Huff geht davon aus, dass diese Summe zukünftig noch ansteigen könnte.

Adobe: 494554694
Allerdings handelt es sich hierbei um Zukunftsmusik, da die Investitionen und Ausgaben für den Abbau, die Anreicherung und die Aufbereitung von Uran weit über denen normaler kommerzieller Energievorhaben liegen. Russlands Rosatom kontrolliert 40 Prozent der Aufbereitungs- und 46 Prozent der Anreicherungsanlagen weltweit. Die Russen haben außerdem gegenüber den westlichen Ländern einen Vorsprung bei der Herstellung neuartiger Kernbrennstoffe für die geplanten Reaktoren der vierten Generation, die mit neuartigen technischen Verfahren arbeiten. Rosatom ist im Übrigen der aktivste AKW-Bauer der Welt, wenn es darum geht, Reaktoren im Ausland zu errichten. Es baut Dutzende von Kernreaktoren in Ländern wie Bangladesch, China, Ägypten, Ungarn etc.
Eine strahlende Zukunft
Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur wird sich die Produktion von Kernenergie bis 2050 verdoppeln. Da sich jedoch die weltweite Energieproduktion insgesamt ebenfalls verdoppeln soll, bleibt der Anteil der Kernenergie voraussichtlich im selben Bereich wie heute, zwischen 8 und 10 Prozent. Ein größerer Marktanteil ist für die Kernenergie schwierig zu erreichen, was weniger am Thema Sicherheit liegt, wie oft vermutet wird, sondern vielmehr an rein wirtschaftlichen Gründen: ein Reaktor kann nur 20 bis 40 Jahre lang in Betrieb bleiben, bevor er abgeschaltet werden muss.
Fachleute gehen davon aus, dass es keinen neuen Atom-Boom wie zwischen 1970 und 1990 geben wird, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens dauert der Bau eines AKW länger als der aller anderen Arten von Kraftwerken, und die Baukosten steigen ständig – Investitionen in neue Kernkraftwerke werden auch zukünftig riskant und kompliziert sein.
Zweitens braucht die Kernenergie im Gegensatz zu anderen Arten der Energieerzeugung die starke Hand des Staates. Die Privatwirtschaft ist in diesem Bereich aufgrund der riesigen Kapitalaufwendungen und Ausgaben für die Forschung ganz einfach weniger wettbewerbsfähig. In vielen Ländern greift die Regierung deshalb zunehmend in den Wirtschaftszweig ein. Etwa 45 Prozent der gesamten Kernkraftkapazitäten weltweit befinden sich momentan komplett in Staatshand, was wohl kaum für eine gesunde Entwicklung der Branche spricht.
Drittens sind die Zwischenfälle, die bei den Anlagen auftreten können, potenziell von einem solch großen Umfang, dass die Kerntechnik bei der Mehrheit der Weltbevölkerung nicht mit uneingeschränkter Befürwortung rechnen kann (auch wenn das Risiko durch den technischen Fortschritt ständig sinkt). Dieser Risikofaktor darf nicht außer Acht gelassen werden. Daher wird der neue Energieboom, wenn er denn kommt, kein atomarer, sondern ein grüner Boom sein.