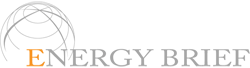Adobe: 585411388
Die weltweiten politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen machen die bitteren Pillen des Green Deal noch ungenießbarer, wodurch er nicht nur zu einer schweren Belastung für den Energiesektor und die Industrie der EU-Mitgliedstaaten werden, sondern auch den rechtsextremen Kräften den Weg zur Macht bereiten könnte.
Grün ist die Farbe der EU, daran zweifelt kaum jemand. Ende 2019 stellte die Europäische Kommission ihr neues Vorzeigeprojekt vor, den Europäischen Grünen Deal. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als eine neue industrielle Revolution auf der Grundlage der erneuerbaren Energien und anderer „sauberer“ Technologien. Der Green Deal wurde zum Arbeitsprogramm für Gesetzesinitiativen und Strategien in den Bereichen Energiewirtschaft, Industrie, Bauwirtschaft, Landwirtschaft und einigen mehr. Die Kommission schlug diesen „grünen Kurs“ als Antwort auf die Klima- und Umweltproblematik ein, gleichzeitig jedoch auch als „neue Wachstumsstrategie“, die bis 2050 das eigentliche Ziel des Green Deal, nämlich die vollständige Energieneutralität der EU, herbeiführen soll.
Indem sie den „grünen Kurs“ zur Priorität erklärte, verlieh EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihrem Mandat eine eindeutige politische Richtung, abgestellt auf die Unterstützung der europäischen Öffentlichkeit sowie derjenigen politischen Kräfte, die ein Vorgehen gegen den Klimawandel für unvermeidlich halten.
Im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament, die in der EU einen neuen politischen Zyklus einläuten, lohnt es sich, den Stand der Dinge und die Errungenschaften des neuen Kurses genauer zu analysieren.
Emissionsreduzierung: das Ziel ist in Sicht
Eines muss man der Kommission lassen: sie hat ehrgeizige Pläne und hat die CO2-Einsparungsziele immer weiter hochgeschraubt. Vielen Industrievertretern erscheinen sie übermäßig streng, doch dank des entschiedenen Vorgehens und der teilweise sehr kostspieligen Maßnahmen sind die Emissionen stark zurückgegangen.
Die Treibhausgasemissionen der EU lagen 2022 um 32,5 Prozent niedriger als 1990. Laut einer Prognose der Forschungsgruppe Global Carbon Project ist es der EU 2023 gelungen, den Ausstoß um weitere 5 Prozentpunkte zu senken. Dieser wesentliche Rückgang der Emissionen ist sowohl den Fortschritten bei der Klimapolitik als auch den hohen Energiepreisen seit Beginn des Ukrainekrieges geschuldet. Auch die umfangreichen Subventionen für erneuerbare Energien haben zum Erfolg beigetragen. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am Energiemix der EU stieg jährlich durchschnittlich um 0,67 Prozentpunkte und lag 2021 bei 21,8 Prozent. 2022 erfolgte ein Anstieg auf 23 Prozent.

Adobe: 768698203
Trotzdem geht die Dekarbonisierung nicht schnell genug voran. Wie Politico im Januar berichtete, legte der EU-Klimabeirat, ein 15-köpfiges Beratergremium aus führenden Klimaexperten, eine Reihe von Empfehlungen für Kurskorrekturen in allen Sektoren der europäischen Wirtschaft vor und drang auf mehr Engagement seitens der Politik. Die Experten gehen davon aus, dass die CO2-Reduzierung ab sofort doppelt so schnell erfolgen muss wie bisher. Nur so kann die EU ihr Ziel erreichen, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Die jetzt vorliegenden nationalen Pläne reichen lediglich für eine Reduzierung um 49 bis 51 Prozent. Noch düsterer sieht es beim rechtlich verpflichtenden Ziel der Energieneutralität im Jahre 2050 aus, von dem die EU momentan noch meilenweit entfernt ist. So schätzte die Europäische Umweltagentur zu Beginn des Jahres, dass die jetzigen Maßnahmen bis 2030 nur eine Reduzierung um 43 Prozent bewirken werden.
Im selben Dokument rufen die Klimafachleute auch zu einer „fast vollständigen Beendigung der Verwendung von Kohle und Erdgas für die öffentliche Strom- und Wärmeerzeugung” bis 2040 auf und kritisieren die EU aufgrund ihrer unzureichenden Maßnahmen gegen die Erdgasnutzung. „Der Standpunkt der EU zum Thema Erdgas ist doppeldeutig und führt zu einem kostspieligen Festhalten am Status Quo bei Infrastruktur und Institutionen und einer verzögerten Abschaffung der fossilen Brennstoffe“, schreiben die Autoren.
Diese Angelegenheit lässt sich natürlich nicht einfach nach dem Willen der europäischen Institutionen lösen: sie müssen hierzu in ein Gebiet vordringen, das den Green Deal zum Stillstand bringen könnte, nämlich in die Energiepolitik der einzelnen Mitgliedstaaten.
Das Problem des einzelstaatlichen Ansatzes bei der Energiepolitik
Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen der Klimapolitik der EU einerseits und ihrer Energiepolitik andererseits. Die Klimapolitik wird erfolgreich auf der EU-Ebene abgewickelt, vor allem seit dem Inkrafttreten des Grünen Deals und der einzelnen Emissionsreduktionsziele. Die Energiepolitik hingegen ist jedoch nach wie vor fragmentiert: die Mitgliedsstaaten betrachten es als ein nationales Vorrecht, ihre eigene Energiepolitik festzulegen.
Um der verschiedenen nationalen Energiesysteme Herr zu werden, müsste die EU ihr Emissionshandelssystem auf sämtliche Wirtschaftsbereiche ausweiten. Dies würde jedoch zwangsläufig mit einem Eingreifen in die energiepolitische Souveränität der Mitgliedstaaten einhergehen. Es ist auch fraglich, ob es der EU gelingen würde, ausreichende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen um zu verhindern, dass das Emissionshandelssystem einen sprunghaften Anstieg der Energiepreise verursacht.
Die Wirksamkeit des Grünen Deals nimmt ab
Europa, ja die ganze Welt, sind nicht mehr das, was sie waren, als der Green Deal zustande kam. Die Mitgliedstaaten hatten damals noch keine Vorstellung von der Energiekrise, die 2022 beginnen sollte, und von den damit einhergehenden einschneidenden Veränderungen der Produktions- und Lieferketten sowie der gesamten Infrastruktur.
Die Klimaexperten sind der Ansicht, dass der grüne Kurs überarbeitet und an die heutigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst werden muss, und zwar in vielen Bereichen, sofern dies überhaupt möglich ist. Marc-Antoine Eyl-Mazzega und Diana-Paula Gherasim vom IFRI Centre for Energy zeigen in ihrem Bericht “How Can the Green Deal Adapt to a Brutal World?” wichtige Aspekte auf, die berücksichtigt werden müssen, um den Green Deal auf die neue Realität auszurichten.
„Russlands Krieg gegen die Ukraine, höhere Zinssätze, Inflation, geschwächte Staatsfinanzen, beeinträchtigte Wertschöpfungsketten und der Fachkräftemangel sorgen für noch nie dagewesene Herausforderungen”, so die beiden Autoren. Laut ihrem Bericht sind sowohl die Bürger als auch die Unternehmen mit so gut wie allen Aspekten des politischen Kurses unzufrieden. Unter den europäischen Landwirten regte sich der Widerstand auf besonders auffällige Art und Weise. Anfang 2024 kamen Bauern aus der ganzen EU auf ihren Traktoren nach Brüssel, um ihrer Wut und Enttäuschung Ausdruck zu verleihen.

Adobe: 496241868
Auch die Brandschutzspezialisten von Fire Safety Europe schlagen Alarm: Innovationen wie Solarzellen, Ladestationen für Elektroautos und Wärmepumpen seien zwar unentbehrlich für die Emissionsreduzierung, stellten jedoch aufgrund der höheren Belastung des Stromnetzes und durch Wartungsprobleme gleichzeitig auch eine potenzielle Brandquelle dar. Sie gehen davon aus, dass der Green Deal mit seiner Betonung auf CO2-Reduzierung durch Innovationen im Gebäudebereich die Brandgefahr noch weiter steigern wird, „wenn der Brandsicherheit nicht Rechnung getragen wird.“
Eines ist klar: vor dem Hintergrund dieser radikalen Veränderungen in Politik und Wirtschaft in den letzten Jahren muss der Green Deal überarbeitet, ja vielleicht sogar umfassend aktualisiert werden, um nicht ganzen Wirtschaftszweigen zum Verhängnis zu werden. Hierfür muss jedoch der politische Wille vorhanden sein. Wird dies nach den Europawahlen im Juni dieses Jahres der Fall sein?
Eine Stimme für das Klima?
Seit den letzten Europawahlen hat sich auch politisch einiges verändert: die Wähler beurteilen die Maßnahmen gegen den Klimawandel jetzt ganz anders als bei den letzten Wahlen, bei denen die „grünen“ Parteien triumphierten.
Die Kritik an den amtierenden Regierungen seitens der Opposition, gerade auch seitens der rechtsextremen Parteien, wird immer lauter. Einer der Hauptkritikpunkte ist der umweltpolitische Kurs der EU.
Eine im März veröffentlichte Umfrage des Marktforschungsunternehmens IPSOS zeigt, dass die Bürger der EU sich jetzt im Vorfeld der Wahlen weniger Sorgen ums Klima machen als in der Vergangenheit. Die Europäer nehmen den Klimawandel nicht mehr als die größte Bedrohung war. Hiermit unterscheidet sich die Stimmung in der EU deutlich von der im Jahr 2019. Vor fünf Jahren fanden in vielen Städten Klimademos und Förderaktionen für erneuerbare Energien statt, und der Kampf gegen den Klimawandel wurde zum beherrschenden Thema im Wahlkampf.
Jetzt allerdings zeigen die Umfragen, dass dieses Thema nur noch für 52 Prozent der Befragten Priorität hat, während 32 Prozent es für zweitrangig halten. Außerdem gaben 54 Prozent der Befragten an, dass ihnen ihre Kaufkraft und die Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards wichtiger seien als der Green Deal.
So wurde auch die kürzlich verabschiedete Verordnung der EU, die die Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbietet, zu einem großen und viel kritisierten Problem. Die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen rief in einem Redebeitrag zu diesem Thema die Mitgliedstaaten der EU auf, „sich die Macht zurückzuholen, die die EU ihnen abgenommen hat.“
Doch nicht nur die französischen Rechten sind gegen den Green Deal: andere europäische Parteien leisten ebenfalls Widerstand. Die niederländische Partei für die Freiheit, die im November 2023 bei den Parlamentswahlen triumphierte, hat erklärt, alle Klimagesetze abschaffen zu wollen. Und dies trotz der Tatsache, dass die Niederlande in der EU beim Kampf gegen den Klimawandel den Ruf eines Vorreiterstaates genießen.
Solche Ansichten werden immer mehr zur Norm. Auch die Parteien der politischen Mitte nehmen einzelne Aspekte des Green Deal ins Visier: in Deutschland verspricht die CDU im Entwurf ihres Wahlprogramms für die Europawahlen, das EU-Verbot für Verbrennungsmotoren aufzuheben. Im Vergleich zu 2019 sticht insgesamt in Europa im Wahlkampf das Fehlen vollmundiger Aufrufe zu einer aggressiven Klimapolitik ins Auge.
Meinungsumfragen zeigen allerdings, dass der Flirt der gemäßigten Parteien mit einer Absage an den radikalen Umweltkurs nicht dazu beiträgt, rechtsextreme Wähler anzulocken. Stattdessen wird die früher als radikal betrachtete Politik der rechten Parteien zunehmend zur Normalität. Hinzu kommt, dass bei den Wählern diejenige Partei am besten ankommt, die als erste Kritik am aktuellen Kurs geäußert hat. Den Nachahmern aus der Mitte des politischen Spektrums hingegen laufen die Anhänger davon. Ein äußerst gefährlicher Trend, vor allem so kurz vor den Wahlen.
Eines ist klar: die neue Europäische Kommission wird sich sehr anstrengen müssen, um die Zukunft des Grünen Deals zu sichern.